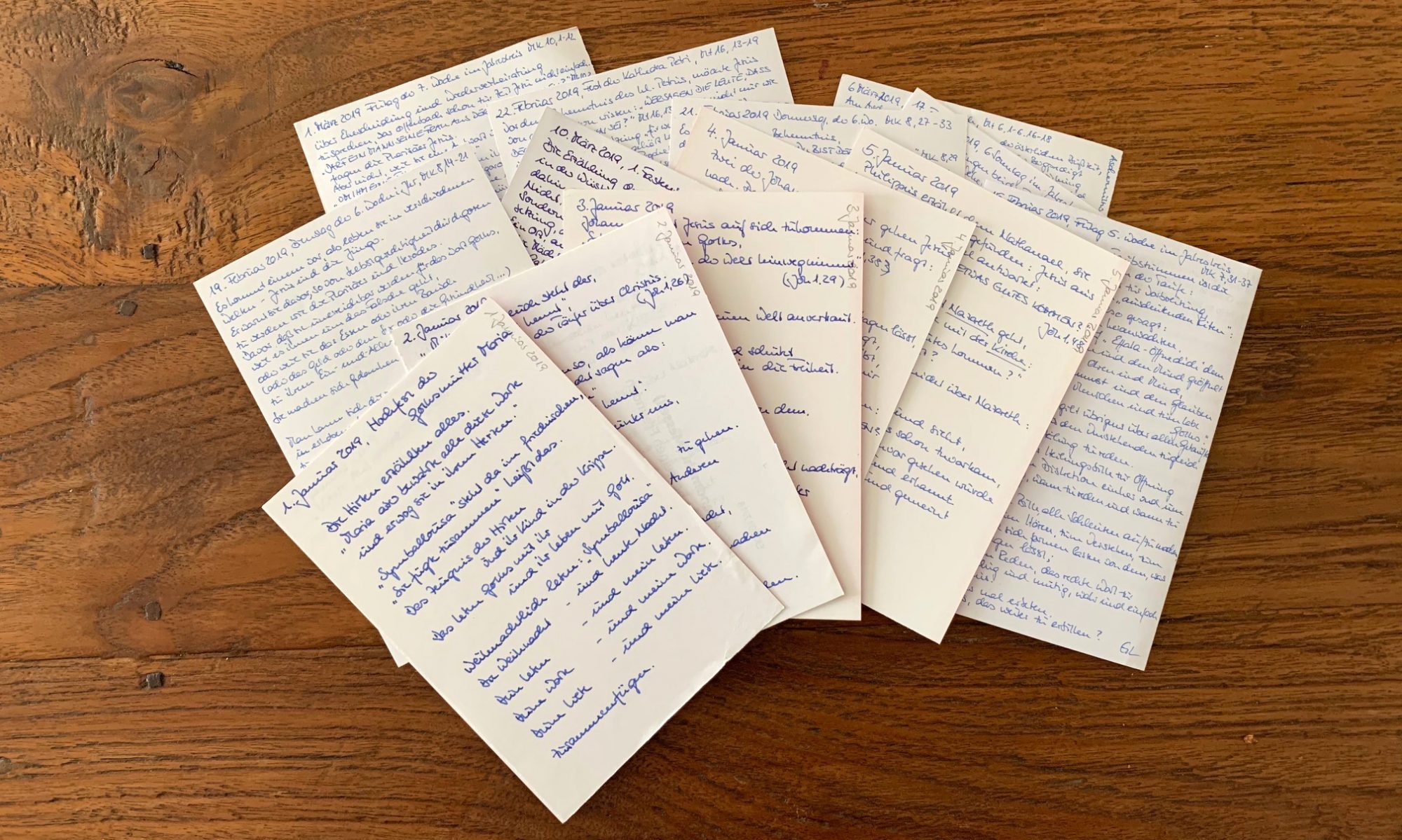Wer mal an der Liebe eines geliebten Menschen zweifelte, weiß: Wirklicher Zweifel ist mehr als die religiöse Koketterie von Intellektuellen. Er ist die Mutter der Verzweiflung.
Der Zweifel des heiligen Thomas ist eine schreckliche Not. Sie hat nichts mit denen zu tun, die arrogant die „Naivität“ der Glaubenden belächeln und damit kokettieren, „sie hätten da so ihre Zweifel“.
Die übrigen Apostel haben den Herrn gesehen. Thomas bleibt außen vor. Er gehört nicht mehr dazu. Die Einsamkeit seines Zweifels muss schrecklich gewesen sein.
Aber Wissen und Glaube sind keine Gegensätze. Streng genommen wissen wir nur das, was sichtbar und erkennbar ist und was wir selbst gesehen und erkannt haben.
Das allermeiste, wovon wir sagen, dass wir es wissen, haben wir anderen geglaubt. Den Eltern und Freunden, den Wissenschaftlern und Journalisten, den Politikern und den Zeugen. Entweder, weil nicht wir, sondern sie es gesehen und erkannt haben, oder weil es prinzipiell unsichtbar ist.
Er wisse, dass England eine Insel sei, schreibt C.S. Lewis, obwohl er es selbst nicht gesehen, sondern anderen geglaubt habe. Alle wirklich großen Dinge, die uns bewegen, sind unsichtbar: Liebe, Würde, Glück, Himmel. Wir müssen sie anderen glauben. Selbst das, was wir sehen, müssen wir glauben.
Zu Thomas sagt Jesus: „Du glaubst [nicht: du weißt], weil du gesehen hast.“ Glaube ist Welterkenntnis. Den Schritt ins Vertrauen kann uns keiner abnehmen.
Wer prinzipiell alles bezweifelt, ist der Verzweiflung nahe. Wir können die Liebe nicht anfassen. Sie fasst uns an. Wenn wir ihr glauben.
(Wdh. vom 3. Juli 2019)
Fra’ Georg Lengerke