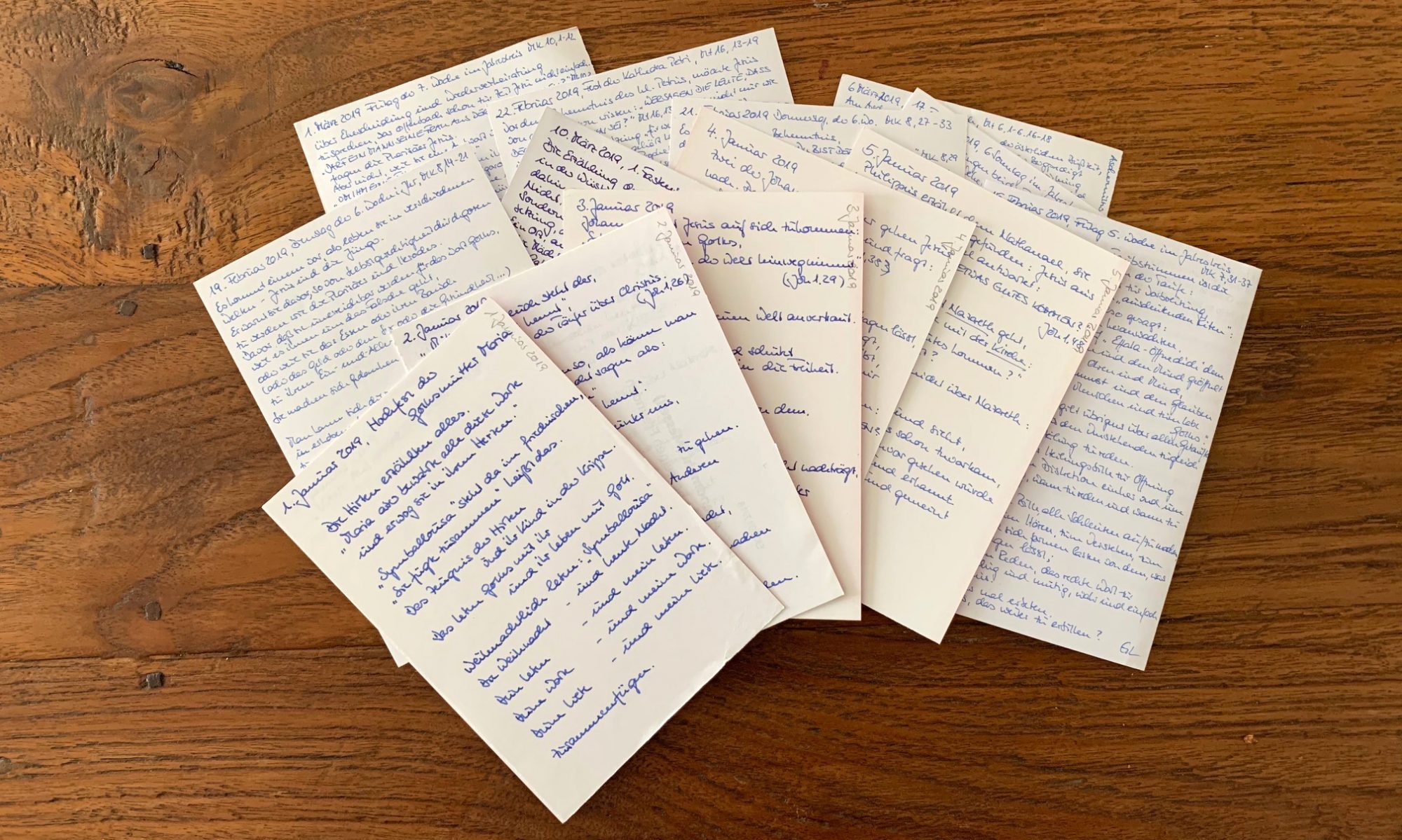In vielen Gemeinden wird heute Erntedank gefeiert. Beim Erntedank muss ich spontan an zweierlei denken: an Fülle und an Verlegenheit.
An Fülle, weil ich als Kind vom Land mit Erntedank kunstvoll drapierte Berge von Früchten und Gemüse verbinde. Von Ähren und Blumen, Wein in Trauben und Flaschen, manchmal sogar von Fisch und Wild. Diese Bilder natürlichen, überbordenden Reichtums haben sich mir tief eingeprägt.
Und an Verlegenheit muss ich denken. Denn, wenn ich ehrlich bin, ist mir früher das Danken nicht immer leichtgefallen. – Aber offenbar geht es auch anderen so. Das Gefühl von Ungenügen beim Dank hat es sogar bis in die klassische Kirchenmusik geschafft: Die sogenannte „Deutsche Messe“ von Franz Schubert aus dem Jahr 1826 ist in katholischen Gottesdiensten noch immer sehr beliebt. Beim Gesang zur Bereitung der Gaben von Brot und Wein für das Abendmahl gibt es allerdings eine Stelle, bei der ich immer stocke, da heißt es:
„Du gabst, o Herr, mir Sein und Leben,
und Deiner Lehre himmlisch’ Licht.
Was kann dafür ich Staub Dir geben?
Nur danken kann ich, mehr doch nicht.“
Ich stocke nicht so sehr wegen der Sache mit dem Staub, der ich angeblich bin. Dazu kommen wir später nochmal. Nein, ich stocke, weil da einer feststellt, dass er nicht „mehr“ tun kann als danken. Was soll das denn sein: mehr als danken? Und ist danken dann weniger? Weniger als was?
Mir scheint, dass das Unbehagen darüber, nicht mehr tun zu können, als zu danken, ziemlich weit verbreitet ist. Bloßer Dank scheint als Reaktion auf einen Gefallen etwas wenig zu sein. Erwartet der andere vielleicht mehr? Und stehe ich jetzt nicht irgendwie in seiner Schuld? Hat er bei mir jetzt etwas gut?
Bei solchen Gedanken geschieht etwas Unheimliches: Aus einem Geschenk wird ein Geschäft.
Dabei danken wir doch für das, was wir geschenkt bekommen, für das, was „gratis“ ist (also: „aus Wohlwollen“). Für das, was umsonst ist, aber nicht vergeblich – ohne Gegenleistung, aber nicht folgenlos.
Ich habe das erst lernen müssen, mir die Freundlichkeit und Güte von Menschen gefallen zu lassen. Es waren Freunde und Verwandte, die mich das gelehrt haben, geliebte oder bekannte Menschen. Und es war meine vielleicht nur anfängliche Erfahrung von Krankheit und Not, die mich die Dankbarkeit gelehrt haben. Und die Erinnerung in bösen Tagen, wie kostbar das ist, was ich in guten Tagen für selbstverständlich hielt.
Dankbarkeit ist nicht nur eine Frage guten Benehmens. (Ich muss daran denken, wie viele Kinder die mahnende Frage „Was sagt man?“ sekundenschnell mit „Danke!“ beantworten.) Dankbarkeit ist vor allem auch eine bestimmte Perspektive auf die Welt. Sie ist eine Weise, die Dinge und Menschen zu sehen. Wer dankbar ist, für den hat die Welt Geschenkcharakter. Für den dankbaren Menschen werden Dinge zu Gaben, Fähigkeiten zu Begabungen und Umstände zu Gegebenheiten.
In vielen Gemeinden wird heute ein Dankfest gefeiert. Ein Dankfest für die Ernte. „Ernte“ kann vieles sein: Zuerst besteht die Ernte in dem, was andere für uns geerntet haben, damit wir leben können. Dann ist Ernte auch das, was wir selbst gesät und geerntet haben – nicht nur in Feld und Garten, sondern auch in unseren Tätigkeiten und Berufen, in unseren Beziehungen und unserer Weise mit uns selbst und anderen umzugehen. Und schließlich geht es bei der Ernte auch um die Ernte unseres Lebens. Um das, was wir sein werden, wenn wir einmal nicht mehr ernten, sondern geerntet werden, um nach Hause zu kommen.
Manchmal höre ich den Einwand, warum wir Städter denn überhaupt noch Erntedank feierten, wo wir doch gar nicht mehr ernten. Vielleicht ist dieses Fest für uns aus diesem Grund sogar noch wichtiger. Denn es erinnert uns auch daran, dass andere für uns gesät und geerntet haben.
Der Erntedank erinnert uns daran, wie viele Menschen Tag für Tag dafür sorgen, dass unsere tägliche Nahrung gesät, geerntet, hergestellt wird und bis zu uns nach Hause kommt. Veränderungen des Klimas, eine Pandemie und Krieg in Europa erinnern uns derzeit daran, wie kompliziert und fragil das System unserer wechselseitigen Abhängigkeit und der Versorgung der Menschen mit dem täglichen Brot ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass der Kühlschrank voll und der Tisch gedeckt ist. Und zwar für keinen von uns!
Ich erinnere mich daran, dass wir in der Schule einmal nachvollzogen haben, wie viele Menschen wie viel arbeiten müssen, damit bei mir etwas auf dem Teller landet. Wie viele von denen arbeiten unter prekären, gefährlichen oder ungerechten Bedingungen? Wie viele mit Fleiß, Hingabe und Freundlichkeit? (Auch wenn ihre Arbeit noch so eintönig ist.) Ich habe mir angewöhnt, bei jedem Tischgebet (laut oder leise) auch für die zu beten, die uns helfen, dass wir zu essen haben. Vom Acker bis zum Teller. Und im Restaurant auch eigens für die Küche – einschließlich derer, die noch bis spätnachts spülen.
Erntedank ist deshalb auch ein Protest- und ein Widerstandsfest gegen die Entfremdung und Entmenschlichung unserer Produktions- und Lieferwege. Diese zu hinterfragen, hat eine alte Tradition. Elisabeth von Thüringen lehnte es schon im 13. Jahrhundert ab, Speisen zu sich zu nehmen, die ungerecht erworben oder erpresst waren. Eine Zeitzeugin auf der Wartburg berichtet, die Heilige sei fest entschlossen gewesen,
„nur die Güter ihres Mannes zu gebrauchen, die sie mit gutem Gewissen gebrauchen könne, was sie so streng beachtete, dass sie, an der Seite ihres Gemahls sitzend, sich beim Mahle von allem enthielt, was von Steuern und der Eintreibung der Steuerbeamten herrührte, und nichts aß, wovon sie nicht wusste, dass es von den Einkünften und rechtmäßigen Gütern ihres Gemahls herkam.“
Als erstes sind es Menschen, denen wir danken. Christen und Gläubige anderer Religionen danken am Erntedankfest darüber hinaus Gott als dem Ursprung aller Gaben. Im Dank an Gott danken gläubige Menschen dem göttlichen Geber hinter allen menschlichen Gebern. Gott ernährt uns immer auch durch die Menschen, die sich um uns sorgen. Denn Gott schenkt den Menschen nicht nur die Saat und die Ernte, sondern auch die Gabe, säen und ernten zu können und füreinander da zu sein.
Der Dank an Gott hat schließlich auch das im Blick, was wir Menschen nicht machen können. Wir können säen und pflanzen, gießen und ernten, aber eines können wir nicht: etwas wachsen machen.
Wir haben bisher von der Ernte im wörtlichen Sinn gesprochen. Aber auch wenn wir nicht selbst in der Landwirtschaft tätig oder Hobbygärtner sind, können uns Saat und Ernte bildlich etwas über unser Leben sagen. Im Neuen Testament der Bibel findet sich zum Beispiel das Bild von der Saat des Wortes Gottes, die in das Leben von Menschen hinein gesät wird:
Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät,
der das Wort hört und es auch versteht;
er bringt Frucht – hundertfach oder sechzigfach oder dreißigfach.
(Matthäus 13,23)
Die Saat wird ist im Evangelium auch ein Bild der Lebenshingabe des Jesus von Nazareth, die nach seiner Auferstehung fruchtbar wird. Kurz vor seinem Tod sagt Jesus zu seinen Jüngern:
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt,
bleibt es allein;
wenn es aber stirbt,
bringt es reiche Frucht.
(Joh 12,24)
Und für den Heilige Paulus sind Saat und Ernte ein Bild für den Tod und die Auferstehung:
So ist es auch mit der Auferstehung der Toten.
Was gesät wird, ist verweslich,
was auferweckt wird, unverweslich.
(1 Kor 15,42)
Aussaat und Ernte können also auch ein Bild für das sein, was wir selbst weggegeben oder investiert haben und später vermehrt oder verwandelt wieder herausbekommen. Auch die von uns, die weder Landwirte sind noch einen Gemüsegarten haben.
Säen ist ein mutiges Geschäft. Der Sämann wirft ja gewissermaßen die Saat weg, versenkt sie im Boden und vertraut sie der Erde an – ohne Sicherheit oder Garantie, dass etwas daraus erwächst. Den Mut und das Vertrauen des Sämanns beschreibt Rainer Kunze in einem Gedicht.
Ich halte ein Samenkorn in der Hand.
Mein einziges Korn.
Sie sagen, ich soll das Korn in die Erde legen.
ich muß mein Korn schützen, mein einziges Korn.
ich habe nie erlebt, daß es Frühling gibt.
Sie sagen, es wächst neues Leben aus dem Korn.
ich verliere mein Korn, mein einziges Korn.
Ich habe nie erlebt, daß es Frühling gibt.
Sie sagen, ich muß mein Korn riskieren, mein einziges Korn.
Aber ich habe nie Frühling erlebt.
Mein Geliebter sagt: es gibt Frühling!
Ich lege mein Korn in die Erde.
Wenn Sie mögen, können Sie sich zum heutigen Erntedank ja mal fragen: Was haben Sie gesät oder investiert in Ihre Anliegen, Pläne und Projekte? In Ihre Familie, Ihre Freunde, in Kunden oder in Menschen in Not? Was haben Sie riskiert? Was haben Sie sich getraut? Und was ist daraus geworden? Wofür haben Sie Grund zu danken – vielleicht zusammen mit denen, die noch mehr davon profitiert haben als Sie selbst?
Auch in diesem bildlichen Sinn können wir für Saat und Ernte danken. Dafür, dass wir säen konnten und gesät haben, dass wir etwas zu verschenken hatten und geschenkt haben – auch und gerade da, wo wir selbst nichts davon hatten. Erntedank kann auch der Dank dafür sein, dass ich anderen eine Freude machen konnte. Für das, was aus unserer Saat wurde. Für das, was wir – wie ein Wort aus den Psalmen sagt – unter Tränen gesät und mit Jubel geerntet haben (vgl. Ps 126,5).
Und wir können für das danken, was frühere Generationen gesät – und wir geerntet haben. Ich muss dabei zum Beispiel an das Holz denken. Die Waldbauern ernten, was ihre Großeltern gesät haben. Und es kann sein, dass durch Unwetter oder Käfer in einem Jahr die Ernte von Generationen verlorengeht. Dasselbe gilt von Entscheidungen und Maßnahmen unserer Vorfahren, von deren Folgen wir heute profitieren – und die oft doch ähnlich gefährdet sind, wie der Wald.
Schließlich kann das Bild von Aussaat und Ernte auch auf die Momente zutreffen, wo wir „Wind gesät und Sturm geerntet“ haben, wie es eine zum Sprichwort gewordene Formulierung der Bibel sagt (Hos 8,7). Ich kann mich beim Erntedank auch an das erinnern lassen, was ich an Üblem gesät und geerntet habe. An bösen Worten, Halbwahrheiten oder Indiskretionen.
„Na, schönen Dank auch!“ mögen Sie sich jetzt denken. Aber es ist gut möglich, dass ich auch hier gute Gründe finde, dankbar zu sein: für eine Vergebung, die ich erbeten und empfangen haben, für eine Wiedergutmachung oder Versöhnung, die möglich wurde, aber auch für das, was ich daraus gelernt und fortan besser gemacht habe. Oder einfach dafür, verschont worden zu sein, wo ich zwar Wind gesät, aber keinen Sturm geerntet habe, der sehr leicht die schmerzliche Folge meines Verhaltens hätte sein können.
Aussaat und Ernte – sie stehen nicht nur für das, was wir haben, sondern auch für das, was wir sind. Wir säen und ernten nicht nur. Irgendwann einmal werden wir auch gesät und geerntet.
In volkstümlichen Darstellungen wird der Tod personifiziert von einem, der die Ernte einbringt – dem „Sensenmann“ oder dem „Schnitter“. Die Bilder von ihm zeigen häufig ein Skelett mit einer Sense oder Sichel in der Hand. Allerdings führen diese Darstellungen vom Sensenmann den Menschen weniger die Ernte vor Augen, sondern das Abmähen und das Abgemähtwerden. Der Sensenmann ist der, der den Menschen vom Leben abschneidet.
Dieses Unheilsbild kommt auch bei den Propheten im Alten Testament der Bibel vor. Beim Propheten Jeremia wird ein Totenlied gesungen über eine in jeder Hinsicht verkommene und vernichtete Stadt. Und die Bilder ähneln denen, die uns auch heute aus den Kriegs-, Hunger- oder Seuchengebieten der Welt erreichen.
“Der Tod ist durch unsre Fenster gestiegen,
eingedrungen in unsre Paläste.
Er rafft das Kind von der Straße weg,
von den Plätzen die jungen Männer.
Rede! So lautet der Spruch des HERRN:
Die Leichen der Leute
liegen wie Dünger auf dem Feld,
wie Garben hinter dem Schnitter;
keiner ist da, der sie sammelt. “
(Jeremia 9,20-21)
Anders klingt es in den Evangelien, den Berichten des Lebens Jesu: Dort steht das Geerntet-Werden der Menschen nicht für das Abgeschnittenwerden aus dem Leben, sondern vielmehr für die Loslösung aus einem alten Lebenskontext und die Hineinnahme in eine neue Lebensform und in eine neue Beziehung zu Gott und den Menschen. Als Jesus seine Jünger aussendet, um das Evangelium zu verkünden und Menschen für ihn und seine Sache zu gewinnen, da sagt er nicht: Vor euch liegt sehr viel Arbeit, es gibt viel zu tun. Sondern er sagt: „Die Ernte ist groß!“ (Mt 9,37)
Am Ende der Bibel werden dann beide Bedeutungen von Ernte zusammengeführt: das Ende unseres irdischen Lebens und das Nachhausekommen der ganzen Menschheit bei Gott. Der „Schnitter“ ist hier nicht mehr ein gruseliges Gerippe mit einer Sense, sondern es ist Jesus Christus selbst. Ihn sieht und beschreibt der biblische Verfasser in einer himmlischen Erscheinung so:
“Dann sah ich und siehe, eine weiße Wolke.
Auf der Wolke thronte einer,
der wie ein Menschensohn aussah.
Er trug einen goldenen Kranz auf dem Haupt
und eine scharfe Sichel in der Hand.
Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel
und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu:
Schick deine Sichel aus und ernte!
Denn die Zeit zu ernten ist gekommen:
Die Frucht der Erde ist reif geworden.
Und der auf der Wolke saß,
schleuderte seine Sichel über die Erde
und die Erde wurde abgeerntet.”
(Offenbarung 14,14-16).
Wenn wir am Erntedankfest auch an das Geerntetwerden denken, dann ist das nicht nur eine Erinnerung an unsere Sterblichkeit. Es erinnert uns auch daran, für das dankbar zu sein, was wir geworden sind. Und zwar durch das, was in unser Leben (von uns selbst oder anderen) bildlich gesprochen „hineingesät“ wurde. Alles, was wir säen, entscheidet mit darüber, wer wir einmal sein werden, wenn unser Leben geerntet wird.
Diese Erinnerung an die Ernte, die wie einmal sein werden, kann eine wichtige geistliche Übung sein, die uns hilft, hier und heute gute Entscheidungen zu treffen. Die Lehrerinnen und Lehrer des geistlichen Lebens empfehlen, sich einmal vorzustellen, das eigene Leben ginge zu Ende. Dabei soll ich mich fragen, wie mein Leben in seiner vollendeten Gestalt, wie meine „Lebensernte“, einmal aussehen soll. Was für ein Mensch will ich am Ende sein? Aus dieser Perspektive dann zurückschauen auf die Gegenwart, und fragen: Wie möchte ich mich angesichts meines vollendeten Lebens heute entschieden haben. Oder im Bild von Aussaat und Ernte gesagt: Was möchte ich angesichts meiner vorgestellten letzten Lebensernte heute in mein Leben säen?
Ich mache diese Übung praktisch jeden Tag. Im Nachtgebet der Kirche schauen die Betenden für einen Moment auf den zurückliegenden Tag zurück. So, als wäre es ihr letzter Tag. So, als legten sie nach Saat und Ernte was von ihrem Lebenstag übrigbleibt in die Hände Gottes zurück. So wird jeder Abend zu einem kleinen Erntedankfest.
Bei diesen kleinen Erntedankfesten denke mittlerweile mehr an die Fülle als an die Verlegenheit. Danken können ist ein Glück. Denn wer dankt feiert, dass er beschenkt ist.
Und wenn ich das tue, dann ahne ich auch, was in der Deutschen Messe gemeint ist, wenn da einer den Schöpfer der Welt fragt: „Was kann dafür ich Staub dir geben?“
Gemessen am Universum bin ich weniger als ein Staubkorn. Aber in den Augen Gottes bin ich unendlich viel mehr als das. In den Augen Gottes ist jeder Mensch das einzigartig erschaffene, ins Leben gerufene, angeschaute und geliebte Kind, dem Gott die Schöpfung anvertraut und dem er ihre Früchte schenkt.
Wenn dieses Geschenk ein Geschenk bleiben und nicht zum Geschäft werden soll, dann bleibt wirklich nichts, als nur zu danken – für jede Saat, für jedes Wachsen und für jede Ernte.
„Nur danken kann ich, mehr doch nicht.“ singt die Gemeinde in Schuberts Messe.
Und ich denke mir: Nur danken kann ich – mehr geht nicht.
(Dieser Beitrag wurde am 02.10.2022 im Deutschlandfunk gesendet.)