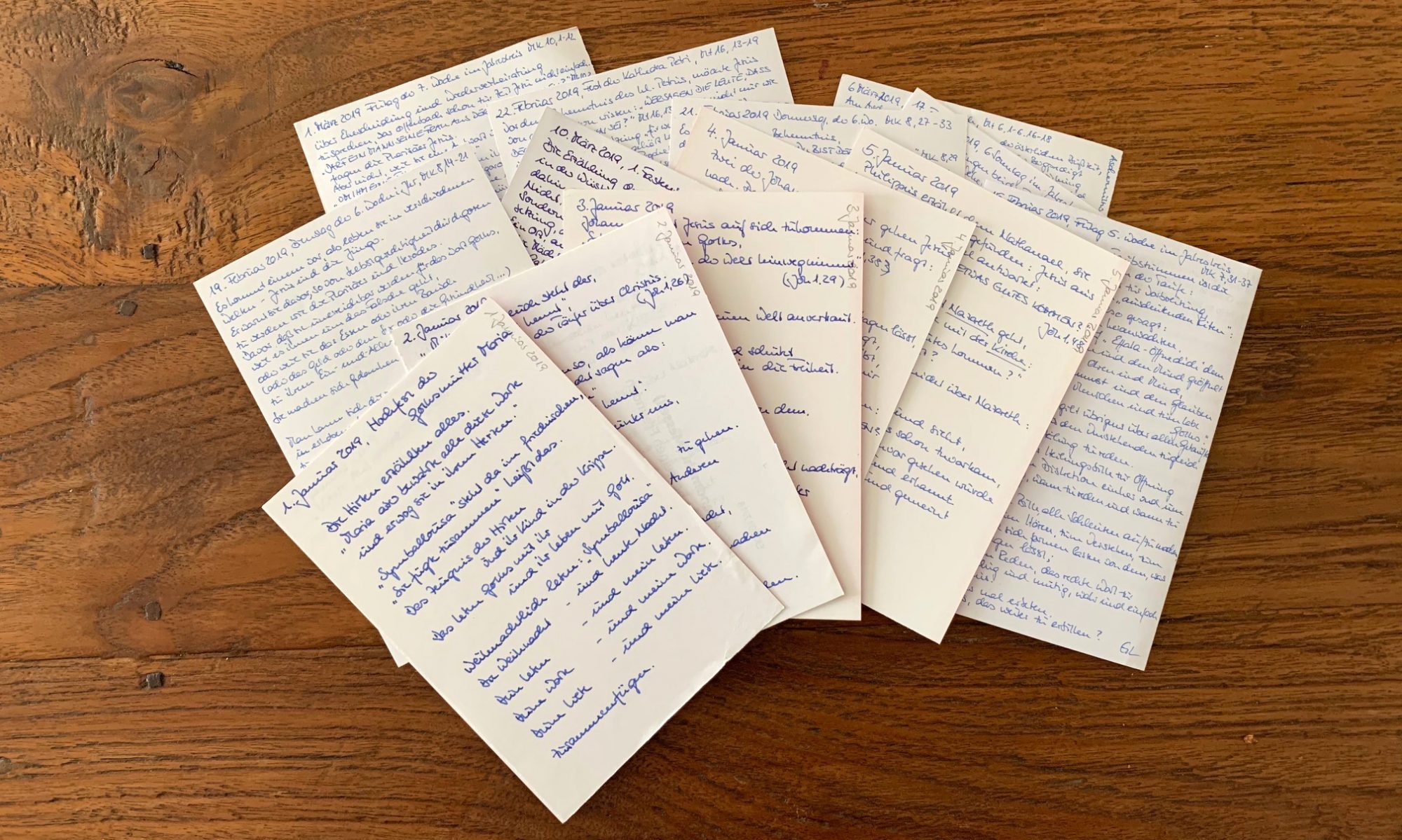Wenn man von Osten kommend den letzten Weg Jesu nach Jerusalem geht, dann ist die letzte Höhe, die man überwinden muss, der Ölberg. Von ihm aus hat man einen berühmt schönen Blick auf die Heilige Stadt und den Tempelberg, bis hinunter in das Tal, wo am Fuß des Ölbergs der Garten Getsemani liegt.
Auf der Bergseite, die der Stadt zugewandt ist, befindet sich der älteste und bedeutendste jüdische Friedhof der Welt. Zwischen zwei- und dreihunderttausend Grabplatten bedecken den Hang. Alle sind in Ost-West-Richtung auf den Tempelberg hin ausgerichtet. Wer einmal hier war, dem kommt sofort die Ähnlichkeit zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin in den Sinn.
Die rabbinische Tradition geht davon aus, dass hier die Auferstehung der Toten beginnt, wenn der Messias kommt und mit den Auferstandenen vom Ölberg durch das bis dahin verschlossene Goldene Tor zum Tempelberg in die Stadt einzieht.
Wenn ich mit Pilgern diesen Friedhof besuche, ist einer der Texte, die wir dort lesen, immer die heutige Lesung aus dem Propheten Ezechiel: „Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf.“ (Ez 37,12b)
In der antiken Synagoge von Dura Europos im Osten Syriens gibt es einen Bilder-Zyklus des Buches Ezechiel, wo unsere Lesung mit einer Stelle aus dem Buch Sacharia verbunden wird: Wenn der Messias kommt, zerbricht der Ölberg und gibt die Toten heraus, die mit ihm in die Stadt ziehen.
Für den modernen Menschen ist die Vorstellung geöffneter Gräber und hervorgeholter Toter schwer erträglich. Zu schnell stellen sich Nachrichtenbilder von Exhumierungen oder Erinnerungen an Filme mit halbverwesten Untoten ein.
Aber dennoch rührt mich dieses Bild der Gräber gegenüber dem Tempelberg und das Zeugnis der Auferstehungshoffnung Israels an. Es ist, als hätten dort die Frommen ihre Toten in Wartestellung beerdigt. Auch ist die so konkrete Vorstellung der Auferstehung dem christlichen Dogma von der „Auferstehung des Fleisches“ ja nicht völlig fremd. Auf wenn wir glauben, dass unser Leib als „verklärter Leib“ auferstehen wird.
Nicht weit vom Ölberg, ein wenig weiter im Osten, liegt Betanien. Das ist der Heimatort des Lazarus, den Jesus im heutigen Evangelium von den Toten auferweckt hat. Denen, die dabei waren, offenbarte sich Jesus schon hier als Herr über Leben und Tod, als der, der sich selbst „die Auferstehung und das Leben“ nennt.
Er wird sterben. Der Hass der Welt wird sich an ihm austoben. Und in alledem bleibt er der ganz mit dem Vater in der Liebe Verbundene. Und in dieser Verbundenheit mit Gott dem Vater besiegt er den Tod – für alle und zusammen mit allen, zu denen er gegangen ist.
Ich glaube, dass der, auf den die Toten am Ölberg warten, schon gekommen ist. Und noch immer im Kommen ist – auch zu ihnen. Dass er den Tod schon überwunden hat und noch immer überwindet – auch um ihretwillen. Dass er hineinführt und hineinführen wird in die Heilige Stadt und das Gelobte Land – die Toten zusammen mit uns.
In jene Stadt und jenes Land, die nicht mehr verteidigt werden müssen und uns nicht mehr genommen werden können, weil selbst der Tod keine Macht mehr hat über sie.
Wenn ich – so Gott will – im Herbst wieder am Ölberg stehe, dann werde ich mitten unter den Gräbern mit den Toten und für sie um diese Ankunft bitten und ihnen sagen, dass ich mich auf sie freue in der Heiligen Stadt, die der Himmel ist.
Fra' Georg Lengerke