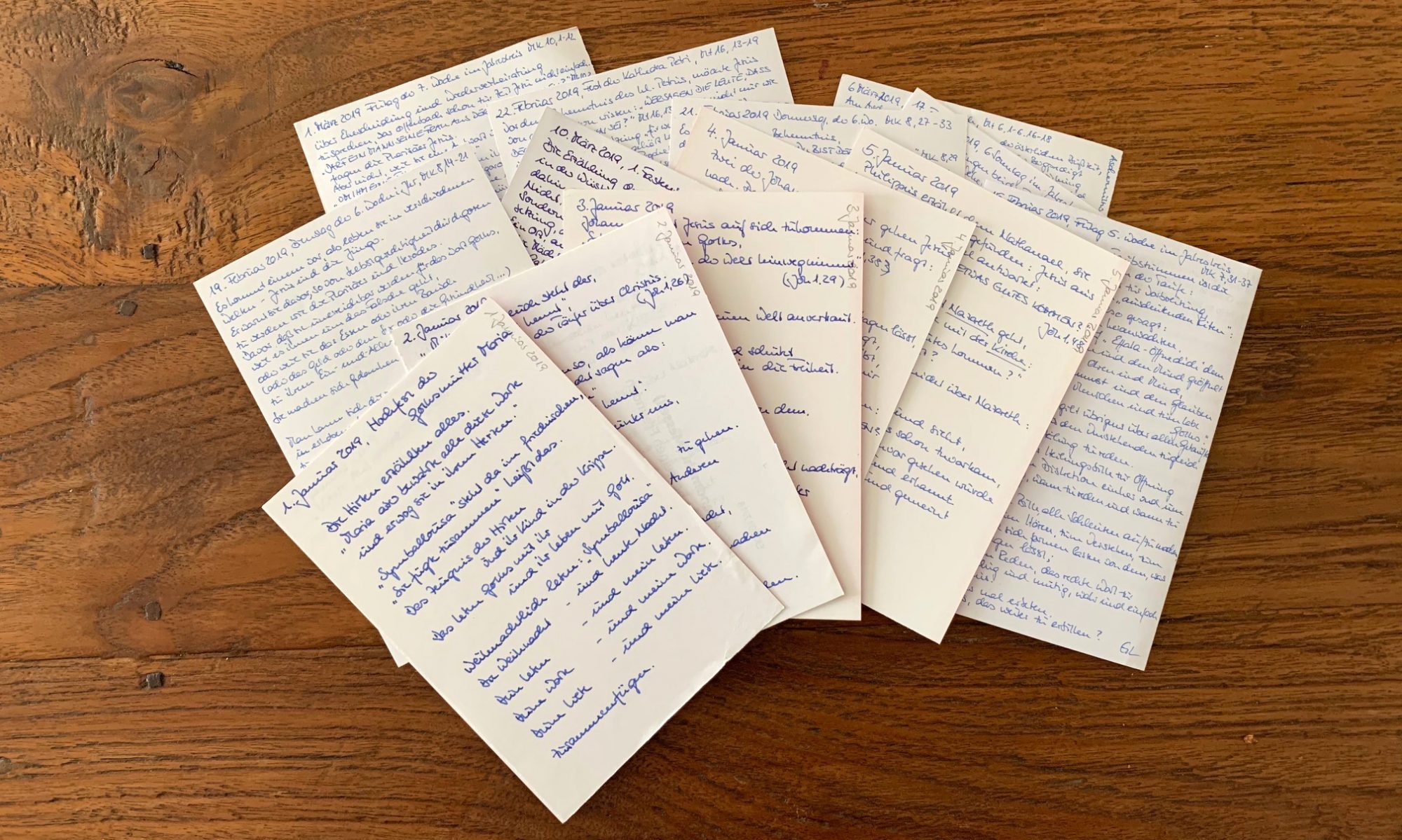Es wurde noch nie so viel geredet wie heute. Und noch nie war die Herausforderung so groß, herauszufinden und zu lernen, wie mit dieser ständig anwachsenden Flut von Worten umzugehen sei.
Für mich ist das eine tägliche Frage. Sowohl bei dem, was ich lese, höre und sehe. Als auch für das, was ich sage und schreibe.
„Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet im Licht, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern“, sagt Jesus.
Die Christen könnten also meinen, es ginge vor allem darum, die Scheinwerfer und die Bühnen zu suchen, um zu reden und zu verkünden… Ja, aber was eigentlich?
Den ersten Jüngern wird gesagt, sie sollten das nahe gekommene „Himmelreich“, „das Evangelium“, „die Umkehr“ und „die Vergebung der Sünden“ verkünden.
Das sollen sie zum einen durch ihre Lebensweise tun und insbesondere durch ihr Dasein für ihre Nächsten. Zum anderen, indem sie den Menschen von Gott erzählen und sie mit Jesus Christus, mit seinem Wort und Wirken und mit der Geschichte Gottes mit seinem Volk von Adam bis heute bekannt machen.
Aber indem ich das schreibe, merke ich, dass das noch nicht alles ist. Dass etwas nicht stimmt, wenn die Kirche einfach nur mitredet und mit ihren – oft nicht mehr verstandenen – Worten (oder mit dem, was ohnehin schon von allen anderen gesagt worden ist) die Wortflut noch mehrt.
Die Christen sollen im Licht von dem reden, was Jesus ihnen „im Dunkeln“ sagt, und auf den Dächern verkünden, was ihnen „ins Ohr geflüstert“ wurde.
Was sagt Jesus denn „im Dunkeln“? Und was wird uns von ihm zugeflüstert?
Gestern hat die Kirche das Geburtsfest Johannes des Täufers gefeiert. Das ist für mich aus zwei Gründen ein besonderes Fest. Zum einen ist es das Patronatsfest der Malteser. Zum anderen ist es der Tag, an dem ich vor 23 Jahren zum Priester geweiht wurde. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich besonders hellhörig bin an diesem Tag.
Jedenfalls muss ich heute daran denken, dass in den Texten dieses Hochfestes mehrmals von einer Vorbereitungszeit in der Stille gesprochen wird.
Zacharias, der Vater des Täufers Johannes, erlebt eine Zeit der Stille, um die Sprache wiederzufinden. Nachdem er die Nachricht von der bevorstehenden Geburt eines Sohnes nicht glaubt, verstummt er für neun Monate – bis das Kind geboren ist. Außerdem scheint er in dieser Zeit auch taub gewesen zu sein, weshalb die Angehörigen ihn zuletzt „durch Zeichen“ fragen, welchen Namen das Kind bekommen soll.
Und von Johannes wird erzählt, er sei schon früh in die Stille der Wüste gegangen, bis das entscheidende Wort ihn findet und trifft. Er bleibt dort „bis zu dem Tag, an dem er seinen Auftrag für Israel erhielt“.
Je gewaltiger die Flut an Worten ist, die über uns hereinbricht, und je trunkener die Menschen von dem Wortrauschen werden, umso mehr ist es an der Zeit, dass Menschen auf das Wort Jesu im Dunkeln hören. Im Dunkel der Ungewissheit und der Angst, im Dunkel der zerbrochenen Beziehungen und Gewissheiten. Je lauter geredet wird, um so wichtiger ist es, still zu werden, um im Dauergerede das geflüsterte Wort von Gott zu vernehmen, auf das es ankommt.
Das Hören im Dunkel braucht Geduld. Das deutsche Wort Geduld und die lateinische patientia haben mit leidvollem Ertragen zu tun. Und das fällt schwer.
Viele Menschen sehnen sich danach, dass Gott ein Machtwort spricht, dass sich mit einem Schlag die Dinge klären oder wenden. Am besten im Sinn des eigenen Lagers und der eigenen Partei.
Ich bitte darum, dass Gott ein Nachtwort spricht. Und dass Menschen da sind, die nächtens wachen und in der Stille das geflüsterte Wort hören, das von seiner Liebe erzählt, die Geduld hat mit uns.
Und wenn der Wortnebel sich legt und ein neuer Morgen anbricht, wird das Gehörte weitergesagt und gerufen und gesungen werden können im Licht und von den Dächern um die Marktplätze der Welt.
Fra' Georg Lengerke