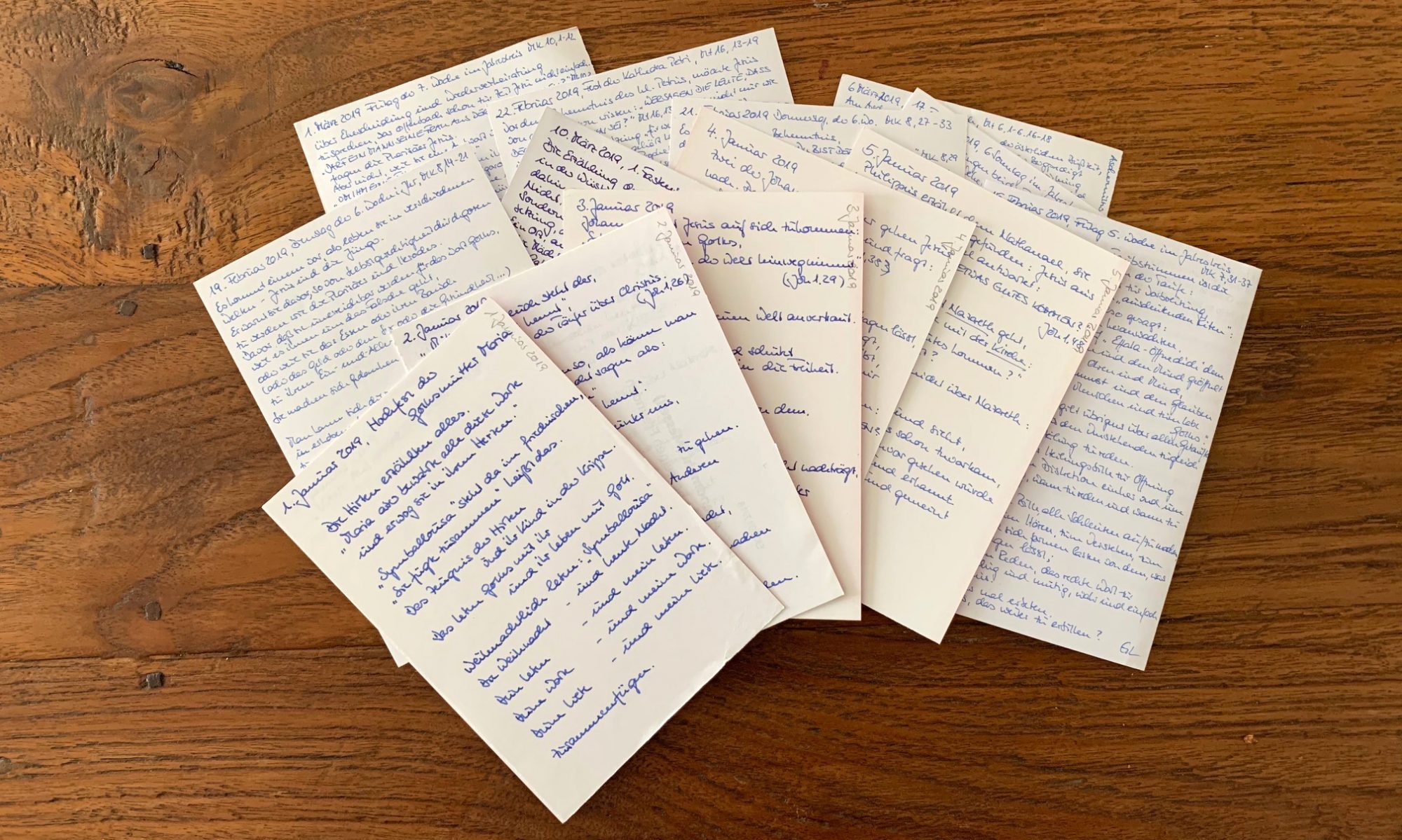„Eure Gunst, unser Streben“ lautet das Motto des Circus Krone hier in München. Für einen Zirkus mag das in Ordnung sein. Als Lebensmotto bewährt es sich nicht.
Ich freue mich, wenn Menschen gefällt, was ich mache. Aber das macht mein Handeln noch nicht gut. Denn vielen gefällt ja auch Belangloses, Unangemessenes oder Böses. Was ich sage und tue, soll wahr und gut sein. Auch dann, wenn es Menschen nicht gefällt.
Deshalb ist umgekehrt auch das Missfallen der Menschen kein Kriterium für die Richtigkeit oder Angemessenheit einer Handlung. Gegen einen Strom zu schwimmen, ist nur dort richtig, wo der Strom in die falsche Richtung fließt.
Egal ob Gefallsucht, Missfallsucht oder Selbstgefälligkeit. Alle drei sind Formen von Korruption.
Im Torquato Tasso lässt Goethe den Tasso die paradiesische „goldne Zeit“ in dem Wort zusammenfassen: „Erlaubt ist, was gefällt.“ Die Prinzessin von Este entgegnet, die goldne Zeit leuchte da auf, wo „erlaubt ist, was sich ziemt“. Aber was ziemt sich?
Die Szene der Taufe Jesu endet mit der Stimme des Vaters, die zu Jesus sagt: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.“ Das wird nicht gesagt, um Jesus zu informieren oder ihn erst zum Gottessohn zu machen. Das ist er schon von Ewigkeit her.
Hier wird öffentlich der Bund Gottes mit den Menschen proklamiert, der in der durchgehaltenen Verbundenheit des Mensch gewordenen Sohnes mit Gott dem Vater endlich vollkommen zum Vorschein kommt.
Wo Jesus steht, da ist zugleich der Ort des einzigen Gefallens, auf das es wirklich ankommt. Im Leben Jesu wird deutlich, was das altertümlich klingende Wort „Gottgefälligkeit“ meint. Gottgefällig ist das wahre und gute Leben aus der Liebe und um der Liebe Willen.
Zu diesem Leben gehört für die Christen, dass sie ihrerseits Gefallen finden an Jesus. Und dass sie es sich schließlich gefallen lassen, dass er bis in alle Tiefen unseres Lebens, unserer Irrungen und Wirrungen, ja bis in unseren Tod hinabsteigt, damit wir alle nach Hause finden –
in das Gefallen Gottes und seine „Gunst“.
Fra’ Georg Lengerke