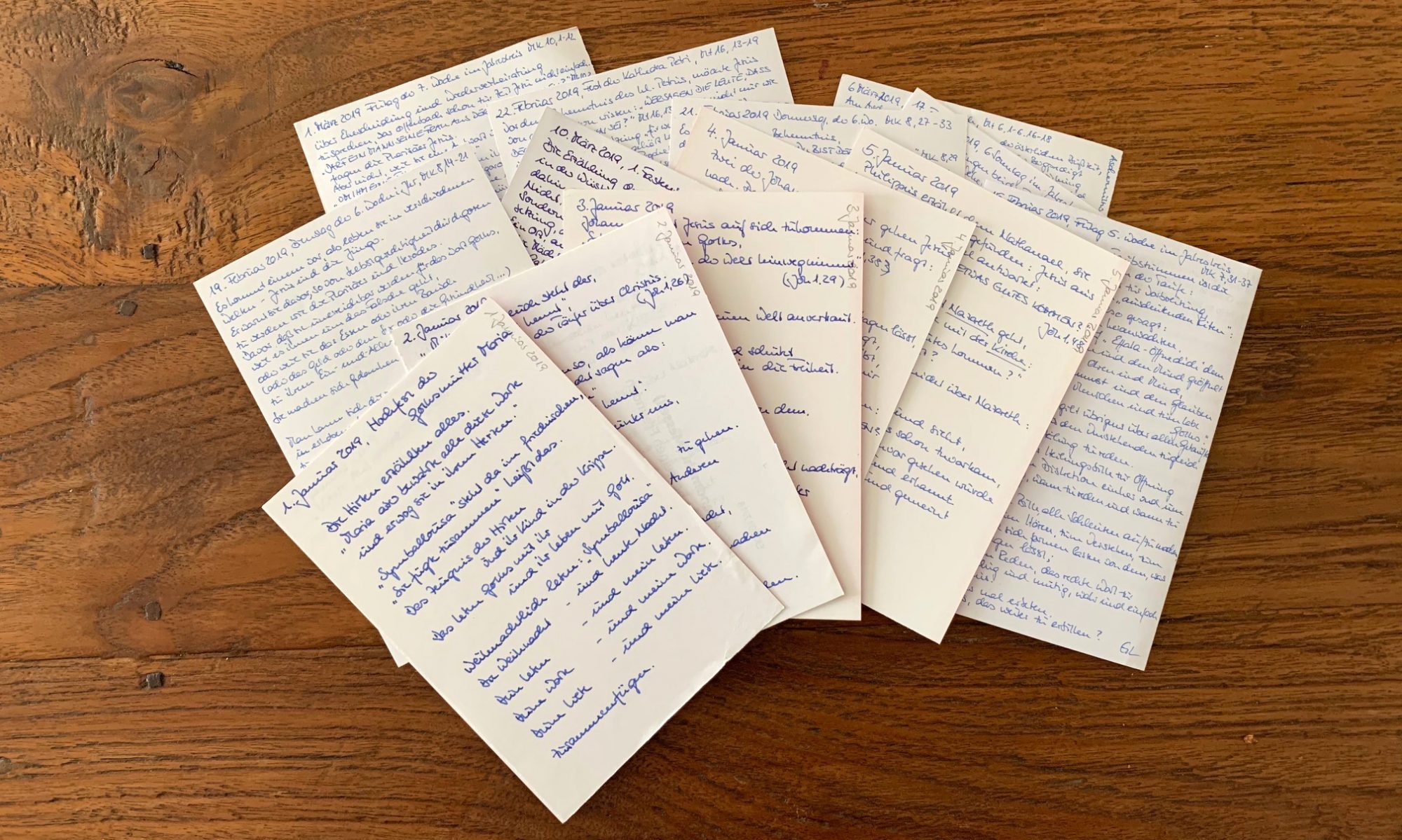Berührungsängste können Leben retten. Zum Beispiel bei Offenplatten, wilden Tieren oder hochinfektiösen Krankheiten. Berührungsängste können auch Leben zerstören. Zum Beispiel bei Meidung von Menschen aus ethnischen, politischen oder religiösen Gründen.
In der Pandemie habe ich viel über die Unterscheidung meiner Berührungsängste gelernt. Es gibt Berührungsängste, die soll ich ernst nehmen und beachten, wenn die Berührung mich in Gefahr bringt. Andere Berührungsängste kann ich einfach vergessen, weil es keinen Grund gibt, Angst zu haben. Wieder andere Berührungsängste soll ich ernstnehmen, weil wirklich Gefahr droht, sie dann jedoch überwinden und die Gefahr der Berührung in Kauf nehmen, wenn ein höheres Gut gefährdet ist.
Jesus berührt einen Aussätzigen. Das war gefährlich und außerdem verboten. Der Mann wird geheilt, und Jesus befiehlt ihm, sich den zuständigen Behörden als geheilt zu melden und ansonsten den Mund zu halten.
Ich könnte mir denken, dass die Erfahrungen der Pandemie das Verständnis dieser Szene bei vielen verändert hat. Viele Menschen haben seither eine höhere Sensibilität. Zum Beispiel für die Gefahr einer Ansteckung, für die Erfahrung der Not von Isolation und Quarantäne oder auch für die Frage der Angemessenheit oder Unangemessenheit von fremdem und eigenem Verhalten oder von obrigkeitlichen Maßnahmen.
Jesus scheint keine Berührungsängste zu haben. Er spürt, dass er den Mann berühren kann und soll und dass diese Berührung für den Mann bedeutet, gesund und wieder in die menschliche Gemeinschaft hineingenommen zu werden.
„Wenn du willst, kannst du machen, dass ich gesund werde“, sagt ihm der Aussätzige. „Ich will – werde rein“, sagt Jesus und berührt ihn. Jesus will, was der Mann will. – Aber der Mann will nicht, was Jesus will. Obwohl Jesus ihm denkbar streng einschärft, von der Sache zu schweigen, erzählt er sie überall herum.
Das führt zu einem Platztausch. Der Mann ist wieder in die Gesellschaft integriert. Jesus jedoch „konnte sich in keiner Stadt mehr zeigen“, weil er fürchten muss, vor der Zeit verhaftet zu werden. Der Geheilte ist drinnen. Der Heiland ist draußen. Damit deutet sich schon an, wie die irdische Lebenszeit Jesu ausgehen wird: Er stirbt draußen, schändlich hingerichtet, als Verworfener.
Jesus hat selbst Berührungsängste gekannt. Wir hören immer wieder, dass er Massenansammlungen oder bestimmte Orte meidet, weil der Entschluss, ihn zu töten, bereits gefasst ist. Im nächtlichen Gebet vor seiner Verhaftung schwitzt Jesus Blut und Wasser vor Angst, weil er weiß, dass von da an jede Berührung ein Schmerz sein wird – beginnend mit dem Kuss des Freundes, der ihn verrät, gefolgt von Schlägen und Demütigungen aller Art.
Schon darüber lohnt es sich für mich nachzudenken, dass Jesus die Berührungsangst zu uns hin überwindet, weil wir es ihm wert sind, sich in die Gefahr unserer Launenhaftigkeit, unserer Unwahrhaftigkeit und unserem tödlichen Umgang miteinander und mit der Schöpfung zu begeben. Gerade dort hält er liebend aus, was wir einander und damit immer auch ihm antun, weil er sich mit einem jeden(!) Menschen verbunden hat.
Die Frage ist immer wieder, ob ich das will. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass der Aussätzige Jesus so nah an sich heranlässt. Auch er hätte Grund gehabt, Berührungsängste zu haben. Nicht nur, weil auch ihm diese Nähe verboten war. Nicht nur, weil er um die Gefahr der Ansteckung des Anderen wusste. Sondern auch, weil es viel Mut und Vertrauen braucht, um jemanden in die Nähe der eigenen Krankheit und Versehrtheit, Entstellung und Unansehnlichkeit zu lassen.
Um solche Berührungsängste zu kennen, muss man nicht erst eine tödliche hochinfektiöse Krankheit gehabt haben. Es gibt Menschen, die haben erfahren, dass die Begegnung mit Gott ihr Leben und Lieben verwandelt hat. Die können uns helfen, dass uns die Berührungsangst vor Gott genommen wird.
Fra' Georg Lengerke