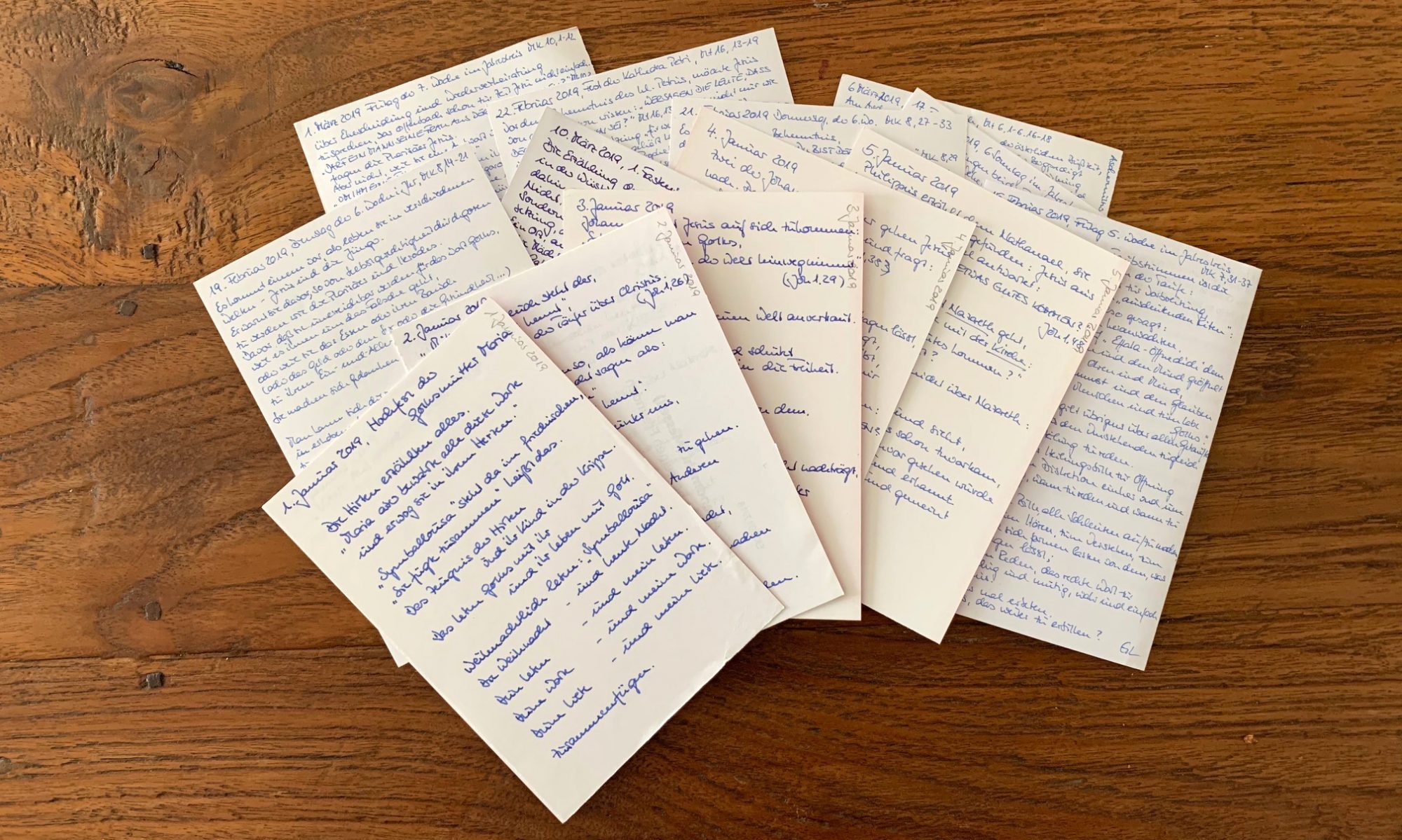Ich stelle mir vor, ich wäre da. Bei diesem Hochzeitsmahl, von dem Jesus sagt, dass es dem Himmel gleicht. Genauer: Ich bin nachgeladen worden. Diesmal wurmt mich das nicht. Fast alle sind nachgeladen. „Gute und Böse“. Der Himmel will sie alle. Das ist mein Glück.
Komische Hochzeit. Hier heiratet ein Königssohn nicht irgendeine fremdländische Schönheit. Er heiratet sein Volk. Die Braut sind wir. Ich gehöre dazu.
Ich denke an die, die abgesagt haben, und frage mich: Habe ich eigentlich zugesagt? Oder bin ich nur so mitgegangen oder sonst wie dahin geraten? Und mir fallen die Träume ein, in denen ich im Schlafanzug in der Messe oder in fremder Leute Haus stehe und nicht weiß, wie ich dahin kam.
Der Mann ohne Hochzeitsgewand kommt mir vor wie einer, der den Himmel noch so mitnehmen will. Wie die letzte Party einer durchzechten Nacht. Er meint, weil die Erstgeladenen nicht erschienen und stattdessen Hinz und Kunz und er und ich eingeladen sind, werde das Fest nun zur späten Stunde verramscht. So wie die Mitnehmsel an der Kasse von IKEA.
Er hat sich nicht mit der Liebe bekleidet, sagen die Kirchenväter. Ohne sie können wir beim Fest zwar dabei sein, aber teilnehmen können wir ohne sie nicht.
Also hole ich meine Zusage nach. Und ich ziehe mir die Liebe an, mit der sich der Bräutigam nach denen sehnt, die abgesagt haben. Sie wissen ja nicht, was sie verpassen. – Wie können sie auch, wenn sie nur so von außen drauf schauen, auf das alt gewordene Haus und die müden Gäste vor der Tür.
Es ist noch Platz. Ich muss noch mal los. Die Freunde holen. Wäre doch zu schade, wenn sie nicht auch noch kämen und hören würden, wie der Bräutigam sagt: „Ich nehme dich an“.
Fra’ Georg Lengerke