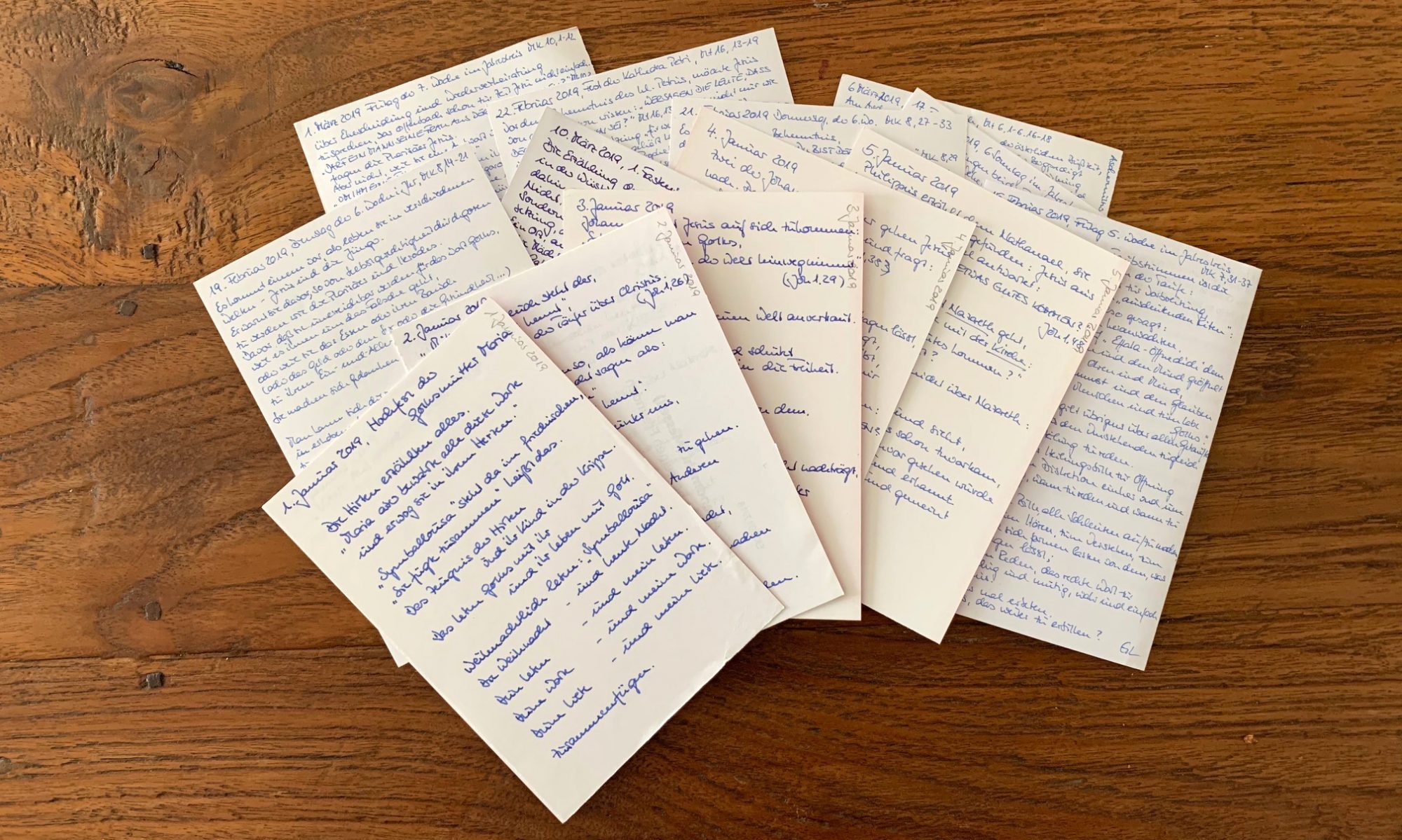Neulich bei den Passionsspielen in Oberammergau: Der dargestellte Jesus war ein ungeduldiger und unleidlicher, schimpfender und schlecht gelaunter Sozialaktivist, von dem kein freundliches Wort zu hören war. „Eigentlich müsste alles anders sein, aber ihr rafft es nicht!“, das war die unfrohe Botschaft des Nazareners aus Oberbayern. In Oberammergau hat mich einiges fasziniert, aber die Christusdarstellung war missglückt.
Auch in der Kirche geht es um Christusdarstellung. Allerdings nicht im Spielen der Rolle eines längst Verstorbenen. Sondern im Sichtbarmachen eines unsichtbar Gegenwärtigen. „Christus ist unter euch“, schreibt Paulus in der heutigen zweiten Lesung (Kol 1,24-28) der Gemeinde von Kolóssä. Deshalb nennt er sie auch „Leib Christi“.
Was gehört zu dieser Sichtbarmachung? Für Paulus gehört dazu, dass im Leiden der Jüngerinnen und Jünger um Christi willen das Leiden Christi selbst sichtbar wird. Zur Sichtbarmachung Christi gehört dazu, dass mit den Gaben und Ämtern Christi der Kirche gedient wird. Und schließlich wird Christus darin sichtbar, dass in der Gemeinschaft mit Ihm auch jeder Mensch vollkommen zum Vorschein kommt.
Auch Maria und Marta von Bethanien, die beiden mit Jesus befreundeten Schwestern, zeigen uns etwas, was später im Leben der Kirche nach Ostern und Pfingsten zur Sichtbarmachung Christi gehören wird:
Die eine, indem sie auf Jesus und mit Jesus auf Gott den Vater hört. Die andere, indem sie Jesus und mit Jesus den Gästen dient.
Beides gehört zum Leben der Christen und der Kirche:
die Kontemplation und die Aktion,
das Hören seines Wortes und das Tun seines Willens,
die Sorge Jesu für uns und unsere Sorge für ihn – und mit ihm für die Menschen.
Wer das Wort Gottes hört, aber nicht tut, was er hört, der ist ungehorsam. Wer dient, aber nicht hört, was er tun soll, der ist unwirksam oder überfordert (oder beides).
Ein Problem der beiden Schwestern ist, dass sie nicht miteinander reden. Maria schweigt. Marta beklagt sich bei Jesus über ihre untätige Schwester und über sein scheinbar mangelndes Interesse an ihrer ganzen Müh und Not.
Wenn Marta von Maria hören würde, was Jesus und die Seinen sagen, würde sie müheloser, fröhlicher und liebevoller dienen.
Wenn Maria von Marta wüsste, wie es ist, für Jesus und die Seinen zu sorgen, würde sie sein Wort wirksamer und bereiter hören.
Die Kirche gleicht mitunter den beiden sprachlosen Schwestern. – Und sie gleicht dem schlechtgelaunten Jesus von Oberammergau, für den eigentlich alles anders sein müsste.
Je mehr wir Heutigen aber mit Marta hörend dienen und mit Maria dienend hören, um so ähnlicher wird die Kirche Christus sein – dem unsichtbar Gegenwärtigen, der in ihr lebt und durch sie sichtbar wird.
Und wo das geschieht, da wird diesem Christus dann glauben, wer will.
Fra’ Georg Lengerke