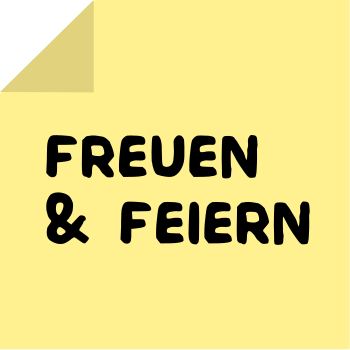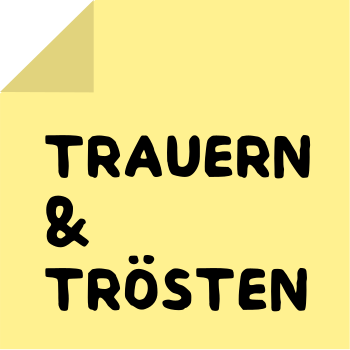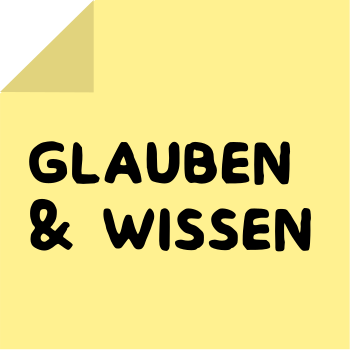BDZ vom 22. Februar 2026
„Daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben.“ (Gen 3,3) „Eigentlich war der Sündenfall doch ein Glücksfall“, sagte mir mal jemand. Endlich sei der Mensch frei, könne Gut und Böse unterscheiden und Verantwortung übernehmen. Aber Adam und Eva wussten schon vorher, was gut und böse war. Wir müssen das Böse nicht tun, um es zu kennen. Sie wussten, dass sie sich die Erkenntnis von Gut und Böse nicht als...
„Daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben.“ (Gen 3,3)
„Eigentlich war der Sündenfall doch ein Glücksfall“, sagte mir mal jemand. Endlich sei der Mensch frei, könne Gut und Böse unterscheiden und Verantwortung übernehmen.
Aber Adam und Eva wussten schon vorher, was gut und böse war. Wir müssen das Böse nicht tun, um es zu kennen. Sie wussten, dass sie sich die Erkenntnis von Gut und Böse nicht als Gott nehmen dürfen, sondern dass sie ihnen von Gott geschenkt werden muss.
Der Sündenfall besteht nicht darin, Gut und Böse zu erkennen. Er besteht darin, diese Erkenntnis an sich zu reißen, um fortan Gut und Böse nach eigenem Gutdünken zu definieren. Er bezeichnet den (uns unbekannten) Moment in der Menschheitsgeschichte, an dem zum ersten Mal ein Mensch wissentlich und willentlich das erkannte Gute unterlassen und das erkannte Böse getan hat.
Der Sündenfall hat die Freiheit des Menschen nicht gemehrt, sondern versaut. Vor dem Fall wird das Leben des Menschen als ungestörtes Lieben und Geliebtwerden, als Lebenseinheit mit Gott beschrieben. Ein Mensch ist für den anderen Versichtbarung (Bild) des unsichtbaren Gottes und seiner Güte. Einer ist Gabe Gottes für den anderen, der ihn annimmt. Einer ist göttliche Hilfe für den anderen, der daher an Gottes Beistand nicht zweifelt. Die Welt ist ein Garten und das Leben eine Bescherung, weil der Mensch alles von Gott empfängt und mit Gott gibt.
Indem der Mensch sich die Erkenntnis von Gut und Böse – und damit die Sicht Gottes auf die Welt – nimmt und sie sich nicht mehr geben lässt, verändert sich alles. Das Verhältnis des Menschen zu seinem Nächsten, zur Schöpfung, zu Gott und zu sich selbst wird beschädigt und tödlich verletzt: Nichts ist mehr Gabe, weil der Mensch keinen Geber will.
Das Bild Gottes wird zu seiner Karikatur. Was göttliche Gabe war, wird zur Beute. Die göttliche Hilfe wird zur untergebenen Dienstmagd. Der Garten (mit seiner Ordnung) wird zum Dschungel (mit seinen Gesetzen). Und die Bescherung wird zur Selbstbedienung um die Wette. Absolute Würde wird zum relativen Wert. Und Menschenrecht zum Recht des Stärkeren.
Dieser tödliche Schaden wird geheilt, so schreibt Paulus der Gemeinde in Rom, indem Gott selbst die Weltbühne betritt: „Wie es also durch die Übertretung eines Einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch die gerechte Tat eines Einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung, die Leben schenkt.“
In Jesus zeigt uns Gott, wie Adam und Eva im Anfang waren: Er ist die Versichtbarung Gottes, die Gabe, in der Gott selbst sich schenkt, Gottes Hilfe und das Dasein seiner Liebe für die Menschen. Der angerichtete Schaden geht an ihm nicht vorbei. Er geht ihn an – mit der ganzen Wucht der geliebten, gefallenen, böse gewordenen Welt. Jesus wird versucht wie wir und hält stand. Er leidet wie wir und mit uns und bleibt doch in der Liebe. Er geht mit uns in den Tod, damit wir mit ihm ins Leben gehen.
In der Fastenzeit sind wir eingeladen, dieses Mitgehen, Mitlieben, Mitversuchtwerden, Mitleiden und Mitsterben und Mitauferstehen neu anzunehmen und zu feiern. Damit wir einander wieder Versichtbarung, Gabe und Hilfe Gottes sind und uns freuen an jener Freiheit, die allein seine Liebe uns gönnen kann.
Fra‘ Georg Lengerke
Link zum Beitrag