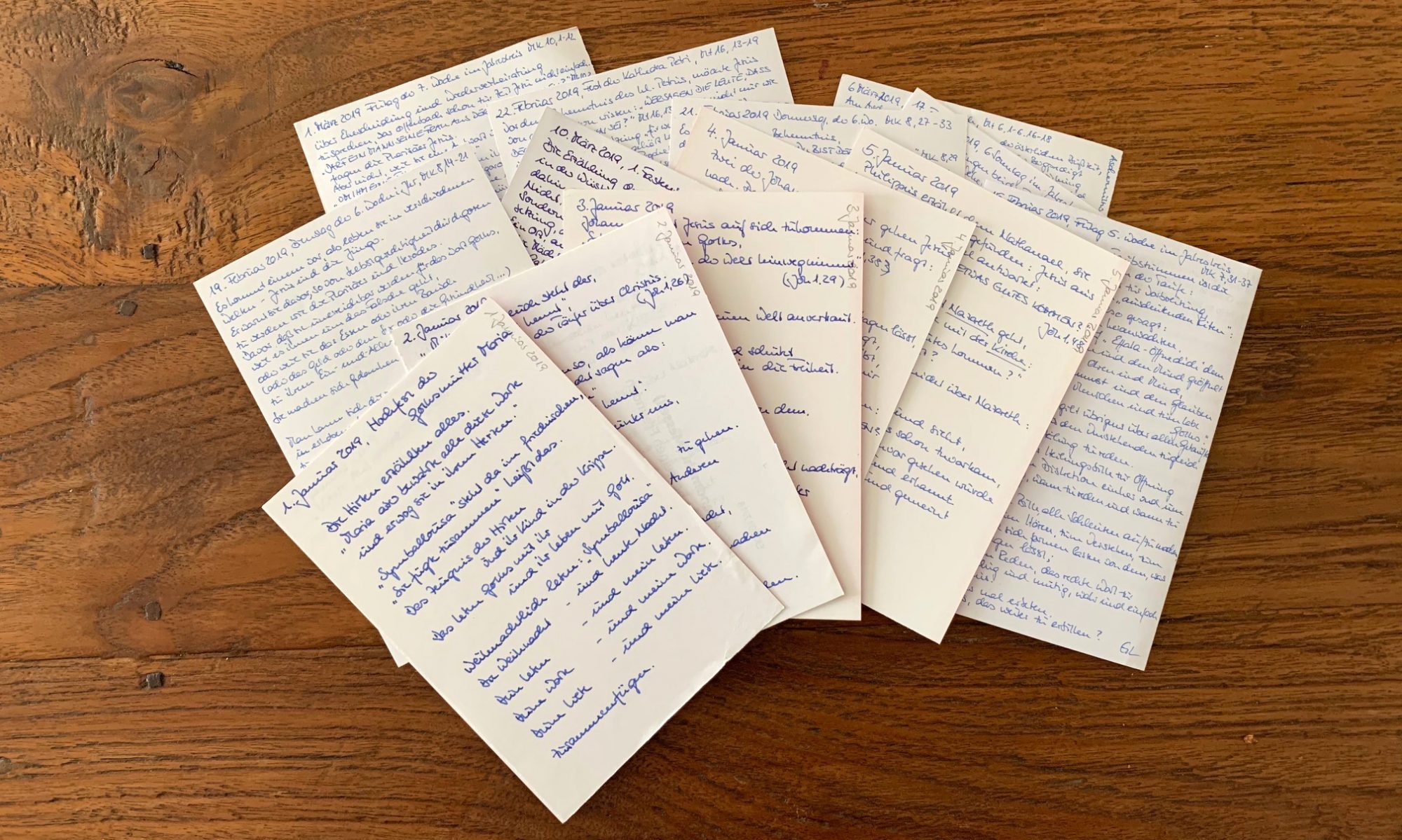„Beam me up, Scotty!” Der Satz gilt als das berühmteste Zitat aus der Serie „Raumschiff Enterprise“. In der Science-Fiction-Serie befindet sich Captain Kirk auf einem Planeten und bittet seinen Chefingenieur Scott, ihn durch „Teleportation“ (also durch Zerlegung hier und Rekonstruktion dort in Sekundenschnelle vermittels Strahlen) wieder ins Raumschiff zurück zu „beamen“. Seither wird es scherzhaft als Wunsch verwendet, aus einer mühsamen oder aussichtslosen Situation augenblicklich herausgeholt und befreit zu werden.
Im Science-Fiction ist das der Befehl an den Chefingenieur. In der irdischen Welt entspricht dem die flehentliche Bitte an Mensch und Gott: „Rette mich!“ und: „Reiß mich heraus!“ (Ps 71,2; 144,7)
Im Johannesevangelium ist für Jesus nach dem Einzug in Jerusalem dieser Moment gekommen. Alle Entscheidungen um ihn herum sind gefallen. Jesus ist im Innersten erschüttert. Und er formuliert die letzte Entscheidung, die noch aussteht: „Was soll ich sagen: Vater, rette mich aus dieser Stunde?“
Das ist ein wichtiger Moment: Bevor Jesus darum bittet, aus dieser Situation gerettet zu werden, fragt er: „Was soll ich sagen?“ Soll ich darum bitten, aus dieser Situation herausgenommen zu werden? Ist gerettet werden das, worum es jetzt geht? Ist es das, was der Vater von mir und für mich will?
Im Gebet geht es vor der Bitte um Rettung oder anderes immer zuerst darum, nach dem Willen Gottes – also nach dem Gerechten, Guten und der Liebe Gemäßen – zu fragen. Deshalb wird im Vaterunser zuerst um die Erfüllung des Willens Gottes und erst dann um das tägliche Brot gebetet.
„Soll ich sagen: Vater rette mich aus dieser Stunde?“, fragt Jesus. Das ist eine echte Frage. Jesus hätte das nämlich tun können. Einem seiner kampfbereiten Jünger sagt er vor seiner Verhaftung: „Glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte?“ (Mt 26,53) Aber er bittet nicht um zwölf Legionen Engel. Er bittet nicht um Rettung aus dieser Stunde. Warum nicht?
„Deshalb bin ich in diese Stunde gekommen“, sagt er. Und bittet: „Vater, verherrliche deinen Namen.“ Das bedeutet: Ich bin in diese Stunde gekommen, damit der Vater da, wo ich bin, und indem ich da bin, wo ich bin, seinen Namen verherrlicht.
Der unaussprechliche „Name“ Gottes steht für seine Anwesenheit, seine Ansprechbarkeit und sein Wirken dort, wo „sein Name wohnt“ (Jes 18,7). Vater, offenbare deine Ansprechbarkeit und dein Wirken!, bittet Jesus hier.
Jesus entzieht sich nicht. Er bleibt. Er hat erkannt: Der Vater braucht ihn gerade hier und gerade jetzt. Er hat hier und jetzt einen Auftrag, den es zu erfüllen gilt und den keiner statt seiner erfüllen kann. Hier und jetzt ist er die Stelle, in der die Liebe Gottes sich als treu erweist. Auch in allem Hass, der ihn treffen wird. Auch im Sterben. Auch im Tod und durch den Tod hindurch.
An diesem Wochenende bin in einem Seminar zum Thema Zeugnis. Kann das sein, dass mein Zeugnis ist, zu bleiben – und darauf zu verzichten aus dieser oder jener mühsamen oder gar gefährlichen Situation herausgenommen zu werden?
Jesus ist die Stelle der Offenbarung Gottes. Und alle, die zu ihm gehören, sollen es mit ihm werden. Für sie geht es nicht mehr nur darum, dass Gott bei ihnen ist. Sondern darum, dass sie bei Gott sind. „Wo ich bin, dort wird auch mein Jünger sein“, sagt Jesus.
„Beam me up, Scotty!” – Die Sache ist die, dass Captain Kirk diesen Satz in der Serie (1966-1969) so nie gesagt hat. Erst 1986, als es schon eine stehende Redewendung ist, greift Captain Kirk den Satz im Spielfilm Star Trek IV auf.
Im Original sagt Captain Kirk: „Two to beam up, Scotty“. Das ähnelt schon eher dem Gebet, das Jesus mit uns einmal beten wird: „Hier sind zwei, die gerettet werden sollen.“ Der Vater holt uns raus aus dem Tod. Zusammen mit dem Sohn. Wenn die Aufgabe erfüllt, der Dienst getan, das Wort gesagt und die Liebe am Ziel ist. Das hat er versprochen.
Fra’ Georg Lengerke