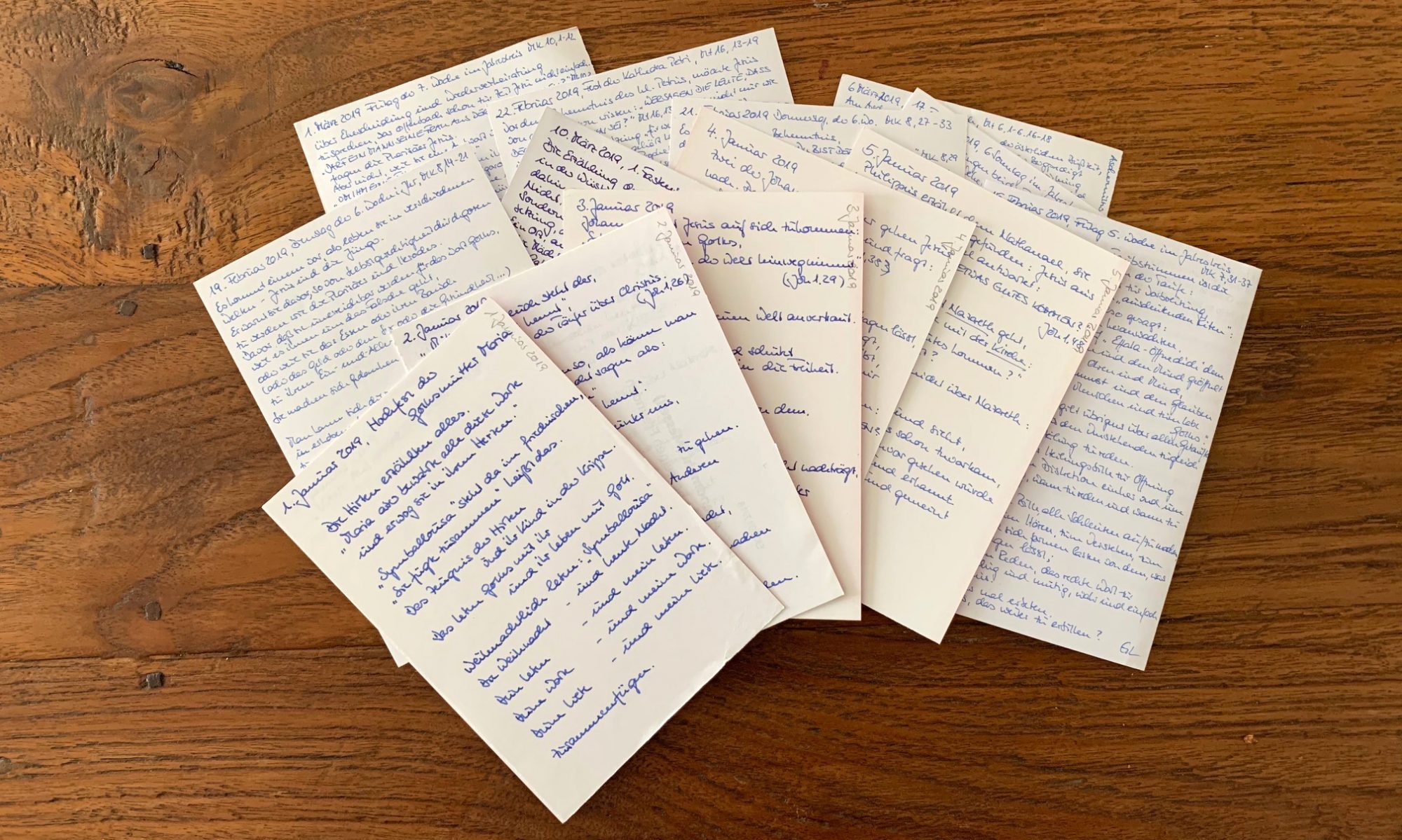Manchmal können wir von einem Menschen sagen: Wir sind einander nahe. Oft müssen wir von Menschen sagen: Wir sind einander fern. – Es kommt aber auch vor, dass wir Menschen nahe sind, die uns fern, oder Menschen uns nahe sind, denen wir fern sind.
Denkt einmal an Eure Beziehungen, in denen es solche Ungleichheit oder Ungleichzeitigkeit gibt: Zu jemandem der mich wiedererkennt, aber ich ihn nicht. Zu einem Freund, der in Depression verstummt, dem ich treu bleibe. Am Anfang die Verliebtheit zu einer, die das nicht ahnt; oder am Ende meine Vertrautheit zu einem geliebten Alten, der mein Gesicht nicht mehr erkennt.
So geht es Gott mit dem Menschen. Die Offenbarung sagt: Gott ist dem Menschen nahe. Immer. Näher, als er sich selbst ist. Aber der Mensch ist Gott nicht nahe. Zumindest nicht immer. Oder mal mehr und mal weniger. „Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu“, schreibt Paulus an Timotheus in der heutigen zweiten Lesung (2 Tim 2,13).
Im Evangelium begegnet Jesus zehn Aussätzigen. Sie bleiben in der Ferne. Aus Ansteckungsgründen waren sie gesetzlich zum Fernbleiben verpflichtet. Sie hätten vor sich warnen und rufen müssen: „Unrein! Unrein!“ (Lev 13,45).
Stattdessen rufen sie aus der Ferne: „Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!“ Aus der Ferne trauen sie sich. Aus der Ferne glauben sie, was man ihnen von Jesus erzählt: Das er denen nah ist, die ihm fern sind.
Jesus stürmt nicht auf sie zu. Von Franz von Assisi erzählte man, er habe seinen Ekel überwunden, sei vom Pferd gestiegen und habe einem Aussätzigen die Hand geküsst. Hier tut Jesus nichts dergleichen. Er verlangt nur, was das Gesetz nach einer Heilung verlangt: „Geht, zeigt euch den Priestern.“ (Lev 14,2-4) – Zeigt euch! Die Aussatz hatten, soll sich aussetzen. Auf dem Weg, heißt es dann, werden sie gesund.
So weit, so gut. Aber die Ferne bleibt. Die aus der Ferne Geheilten bleiben in der Ferne. Sie nehmen es selbstverständlich. Sie mögen sich denken: Was ich habe, habe ich. Nichts wie weg.
So denken sie alle. Außer einem. Einem Fremden. Einem doppelt Fremden. Einem Aussätzigen aus Samarien. Kein Jude, sondern einer von außen. Er kehrt zu Jesus zurück, um zu danken und Gott die Ehre zu geben. Nicht mehr aus der Ferne, sondern aus nächster Nähe. Nicht mehr vor sich warnend, sondern aus sich jubelnd.
Ich kenne Menschen, die sich nicht zu beten, zu singen oder in die Kirche trauen, weil sie sich Gott fern finden. Aber wir sollen nicht warten, bis wir meinen, wir seien Ihm nah genug. Er ist uns nah, wenn wir Ihm fern sind. Also können wir aus der Ferne rufen. Und wenn wir merken, dass wir Grund zum Danken haben, dann werden wir – wie der Aussätzige aus Samarien – auch merken, dass wir in die rettende Nähe dessen gekommen sind, der uns schon nahe war, als wir ihm noch fern waren.
Fra’ Georg Lengerke