Heute morgen fand sich ein kleiner Tippfehler in einer Stundenbuch-App, die dem Wort vom gesäten Wind und geernteten Sturm nochmal eine ganz neue Tiefe verleiht.
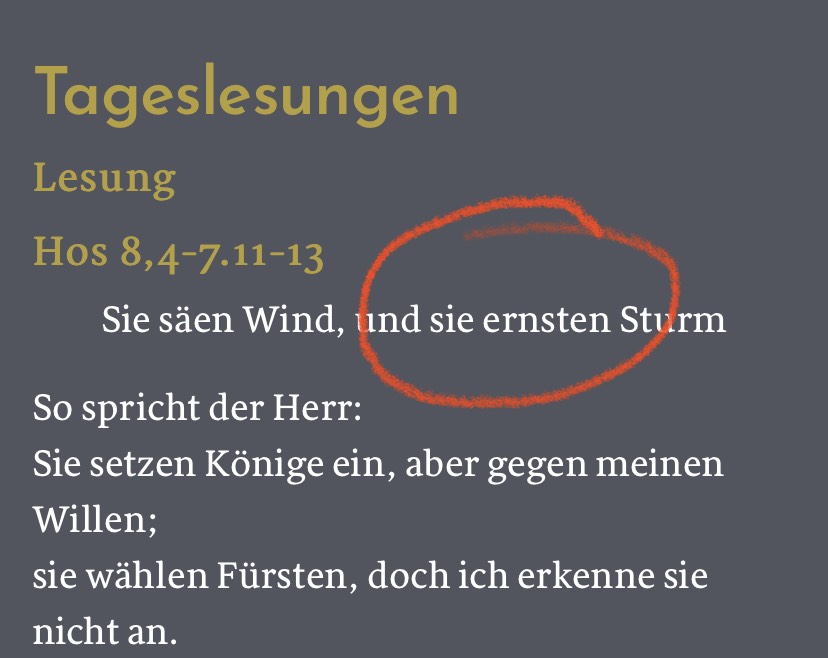
Heute morgen fand sich ein kleiner Tippfehler in einer Stundenbuch-App, die dem Wort vom gesäten Wind und geernteten Sturm nochmal eine ganz neue Tiefe verleiht.
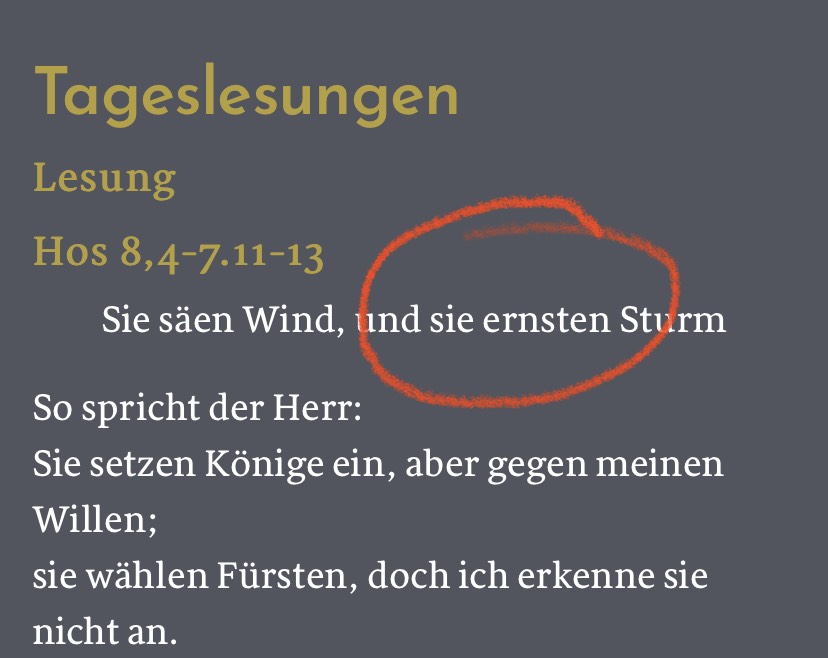
Das Bild von Saat, Frucht und Ernte ist in der Heiligen Schrift oft positiv besetzt. Es handelt vom Weggeben und vom Wachsenlassen (auch während des Schlafs), von der Ernte und der vielfachen Frucht. Aber es gibt auch das Gegenbild davon, dass Zwietracht, Verleumdung und Unrecht gesät werden.
Ein solches Bild gibt uns der Prophet Hosea: „Sie säen Wind und ernten Sturm.“ Es richtet sich an das Volk Gottes, das zu ihm ruft, wie zu einem alten Bekannten, aber ihn selbst gar nicht mehr meint, das gegen Gottes Willen Könige einsetzt und sich Ersatzgötter macht, die doch zerstört werden.
Die Sturm-Ernte von all dem findet sich in den in der Lesung ausgelassenen Versen 8-10: Israel hat sich den Völkern bis zur Unkenntlichkeit angepasst und angedient – so sehr, dass es von den Völkern „verschlungen“ wird. Es kehrt zurück dorthin, von wo Gott es einmal befreit hat: „Sie müssen zurück nach Ägypten.“
Wir können das Bild von der Saat des Windes und der Ernte des Sturmes für uns selbst, unsere Familien und kleinen Gemeinschaften und für die Kirche als Volk Gottes hören:
Wir säen den Wind
einer schlechten Gewohnheit
und ernten den Sturm
dynamischer Schrulligkeit.
Wir säen den Wind
verächtlichen Geredes
und ernten den Sturm
von Ressentiment und Sprachlosigkeit.
Wir säen den Wind
eines Grundrauschens aus Worten
in unsere Echokammern,
und ernten den stillen Sturm
einer plaudernden Kirche ohne Gott.
Wir säen den Wind
eines behaupteten Konsenses
und ernten den Sturm
von Scheidung und Spaltung.
Du säst den Wind
Deines Geistes
in unser Empfinden und Verstehen,
in unser Entscheiden und Tun,
und erntest den Sturm
der Erneuerung der Welt.
Amen.
Fra’ Georg Lengerke
„Klingt, als wenn man ein wenig unbedarft und naiv sein müsse“, sagt die junge Freundin auf dem Beifahrersitz. „Ich mag nicht ‚Lass mich einfältig werden…‘ singen – auch wenn ich ‚Der Mond ist aufgegangen‘ eigentlich ganz gerne habe“ fügt sie noch schnell hinzu.
Eben hatte sie mir das Evangelium vorgelesen, damit wir über einen BetDenkzettel für heute nachdenken.
Jesus verachtet Klugheit, Weisheit und Bildung nicht. Er warnt uns aber vor jenem nutzlosen Vielwissen, das unseren Blick aufs Wesentliche verstellt, unser Gewissen korrumpiert und uns die Kriterien guten Entscheidens verlieren lässt.
Den Unterschied zwischen „den Weisen und Klugen“, denen der Sinn der Worte Jesu verborgen bleiben, und den „Unmündigen“, denen er offenbar wird, hat Matthias Claudius im Lied vom Mond schön beschrieben.
Für die Weisen und Klugen gibt es nur das, was sie selbst gesehen haben. Über das Unsichtbare lächeln sie. Aber auch der Mond ist „nur halb zu sehen und ist doch rund und schön“.
Spätestens Corona hat uns gelehrt, dass „Wissenschaft“ uns nicht Zwecke und Ziele, sondern nur die Wegbedingungen dorthin erkennen lässt. Wenn sie behauptet, zu wissen, worauf es ankommt, ist sie „Luftgespinst“, das uns nur „weiter von dem Ziel“ kommen lässt. Jürgen Habermas sagte neulich: „So viel Wissen über unser Nichtwissen gab es noch nie“.
Der Horizont der „Weisen und Klugen“ ist ihr Wissen. Sie „trauen Vergänglichem“. Der Horizont der Unmündigen ist „Gott“ und sein „Heil“ – ihr Horizont ist der Himmel, der hier beginnt.
Von ihnen sollten wir lernen, wenn wir nicht nur viel wissen, sondern auch „wie Kinder fromm und fröhlich sein“ wollen.
Fra’ Georg Lengerke
Zu den Varianten und der Geschichte des Abendliedes weiß Wikipedia mehr: https://de.wikipedia.org/wiki/Abendlied_(Matthias_Claudius)
Wer mal an der Liebe eines geliebten Menschen zweifelte, weiß: Wirklicher Zweifel ist mehr als die religiöse Koketterie von Intellektuellen. Er ist die Mutter der Verzweiflung.
Der Zweifel des heiligen Thomas ist eine schreckliche Not. Sie hat nichts mit denen zu tun, die arrogant die „Naivität“ der Glaubenden belächeln und damit kokettieren, „sie hätten da so ihre Zweifel“.
Die übrigen Apostel haben den Herrn gesehen. Thomas bleibt außen vor. Er gehört nicht mehr dazu. Die Einsamkeit seines Zweifels muss schrecklich gewesen sein.
Aber Wissen und Glaube sind keine Gegensätze. Streng genommen wissen wir nur das, was sichtbar und erkennbar ist und was wir selbst gesehen und erkannt haben.
Das allermeiste, wovon wir sagen, dass wir es wissen, haben wir anderen geglaubt. Den Eltern und Freunden, den Wissenschaftlern und Journalisten, den Politikern und den Zeugen. Entweder, weil nicht wir, sondern sie es gesehen und erkannt haben, oder weil es prinzipiell unsichtbar ist.
Er wisse, dass England eine Insel sei, schreibt C.S. Lewis, obwohl er es selbst nicht gesehen, sondern anderen geglaubt habe. Alle wirklich großen Dinge, die uns bewegen, sind unsichtbar: Liebe, Würde, Glück, Himmel. Wir müssen sie anderen glauben. Selbst das, was wir sehen, müssen wir glauben.
Zu Thomas sagt Jesus: „Du glaubst [nicht: du weißt], weil du gesehen hast.“ Glaube ist Welterkenntnis. Den Schritt ins Vertrauen kann uns keiner abnehmen.
Wer prinzipiell alles bezweifelt, ist der Verzweiflung nahe. Wir können die Liebe nicht anfassen. Sie fasst uns an. Wenn wir ihr glauben.
(Wdh. vom 3. Juli 2019)
Fra’ Georg Lengerke
Die Begegnung Marias mit ihrer Verwandten Elisabeth rührt mich an. Aber sie ist keine Idylle. Das wissen die Mütter unter Euch am besten. Es ist der Anfang eines Dramas von größter Freude und größtem Schmerz.
Dieses Jahr denke ich bei dieser Szene an die jungen Mütter um mich. Und an die, die gerne Mütter würden. An die, die ein Kind erwarten und nicht wissen, wie es gehen soll. An die, deren Kind schon im Sterben liegt, bevor es geboren ist. An die, die vor Entscheidungen stehen, die keiner treffen kann und vor die sie keiner stellen darf. Und ich denke an die, die auch in Schmerzen guter Hoffnung sind.
Die beiden Mütter sind Trägerinnen von Frage und Antwort. Johannes ist die Frage. Jesus ist die Antwort. Es ist Johannes, der hüpft. Nicht Jesus. Von ihm hören wir nur, dass er da ist. Da für Johannes. Da für uns – „von Kindesbeinen an“.
Dieses Kind ist derselbe, der auf Golgatha sterben wird und an den Platz aller Leidenden und Sterbenden aller Zeiten und Orte geht. Er schreit unseren Schrei nach Gott und bekommt zu Lebzeiten keine Antwort. Die Antwort, die ergeht, ist der fragende Sohn selbst. Schon als Leidender – dann als Auferstandener.
„Wo ist Gott, wenn man ihn braucht?“, schreibt mir dieser Tage eine Mutter und Großmutter, der gerade ihr lebenslanges Beten vergeht. „Er ist dort, im Bauch der Mutter. Er ist ein Kind geworden, um eins zu sein mit dem Kind, das sterben wird“, überlege ich zu sagen.
Aber die Wahrheit klingt hohl, wenn ihre Stunde noch nicht da ist. „Die, die noch beten können, sollen es stellvertretend tun“, schreibt sie mir. Ich denke an Johannes. Und ich verspreche, es zu tun.
Fra’ Georg Lengerke